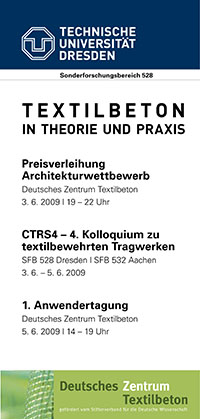4. Kolloquium der Sonderforschungsbereiche 528 (Dresden) und 532 (Aachen) zusammen mit erster Anwendertagung des Deutschen Zentrum Textilbetonzentrum
Bei der Textilbeton-Tagung vom 3. – 5. Juni 2009 in Dresden treffen sich Wissenschaftler zweier Sonderforschungsbereiche und Praktiker, um umfassend über den neuen Verbundbaustoff Textilbeton zu informieren und die Ergebnisse der Forschung zu diskutieren. Die beiden Sonderforschungsbereiche der DFG „Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung“ (SFB 528, TU Dresden) und „Textilbewehrter Beton – Grundlagen für die Entwicklung einer neuartigen Technologie“ (SFB 532, RWTH Aachen) führen ihr Kolloquium zu textilbewehrten Tragwerken bereits zum vierten Mal durch. Neu ist, dass die CTRS4 am Nachmittag des zweiten Tages erstmals eine Anwendertagung des Deutschen Zentrum Textilbeton angeboten wird, in dem von ersten Anwendererfahrungen berichtet wird. Am Vorabend von CTRS4 werden in einer Feierstunde die Preisträger des ersten Architekturwettbewerbes gewürdigt, der vom Deutschen Zentrum Textilbeton für Hochschulstudenten ausgelobt wurde.
Während die Vorträge am 4. Juni 2009 wesentliche Ergebnisse aus der laufenden Grundlagenforschung vorstellen werden, stehen am 5. Juni 2009 die Erfahrungen aus Textilbeton-Anwendungen im Mittelpunkt des Interesses. Diese Vorträge werden insbesondere auf folgende Fragestellungen eingehen:
- Lieferbarkeit und Kosten textiler Verstärkungsstrukturen
- Bereitstellung von Feinbetonmischungen in geeigneter Aufmachung
- Qualitäts- und Überwachungsanforderungen bei Bauwerksverstärkungen
- Wege zur Zustimmung im Einzelfall
- Wirtschaftlichkeit von Instandsetzungs- und Verstärkungsmaßnahmen
- Aktuelle Projekte in Realisierung
- Anwendungspotentiale außerhalb des Bauwesens
- Kreative Bauteilentwicklungen und
- Das Leistungsangebot des Deutschen Zentrums Textilbeton für die Wirtschaft
Weitere Informationen auf den Seiten des SFB 528
Informationen zum DZT