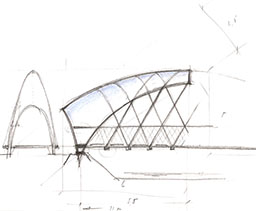Am 9. Juni 2010 hat der Senat der TU Dresden drei Kandidaten für das Rektoramt bestätigt. Die Kandidaten sind dem Senat am 9. Juni 2010 vom Hochschulrat gemäß dem Sächsischen Hochschulgesetz §82 vorgeschlagen worden. Der Rektor der TU Dresden für die Amtszeit 2010 bis 2015 wird am 16. Juni 2010 vom Erweiterten Senat der TU Dresden gewählt.
Für das Amt des Rektors kandidieren:
- Prof. Dr.-Ing. Gerhard P. Fettweis
- Prof. Dr. phil. habil. Karl Lenz und
- Prof. Dr.-Ing. habil. Hans Müller-Steinhagen.
Prof. Fettweis (48) studierte von 1981 bis 1986 an der RWTH Aachen Elektrotechnik und diplomierte dort. An der gleichen Hochschule promovierte er im Jahr 1990 zum Dr.-Ing. in Electrical Engineering. Seit September 1994 ist Prof. Fettweis Inhaber des Vodafone Stiftungslehrstuhls Mobile Nachrichtensysteme an der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Dresden. Prof. Fettweis lehrt und forscht auf dem Gebiet der Übertragungstechnik für mobile Nachrichtensysteme. Er gründete im Jahr 2007 das BMBF-Spitzencluster „Cool Silicon/Energy Efficiency from Silicon Saxony“ und war bis 2010 dessen Sprecher.
Er ist verheiratet und hat fünf Kinder.
Prof. Lenz (54) studierte von 1974 bis 1980 Soziologie, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1985 promovierte er und 1991 habilitierte er sich jeweils zu soziologischen Themen. Seit 1992 ist er Professor für Mikrosoziologie an der TU Dresden. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Soziologie persönlicher Beziehungen; Hochschulforschung, Interaktion und Kommunikation, Soziologie der Geschlechter und Qualitative. Prof. Lenz ist seit 1994 (mit Unterbrechungen) Geschäftsführender Direktor des TUD-Instituts für Soziologie, war Studiendekan und Dekan der Philosophischen Fakultät. Seit 2006 ist er Prorektor für Bildung der TU Dresden.
Prof. Müller-Steinhagen (56) diplomierte 1980 im Fach Maschinenbau an der Universität Karlsruhe. Vier Jahre später promovierte er dort in Verfahrenstechnik. 1999 habilitierte er sich zu einem Thema der Angewandten Thermodynamik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Prof. Müller-Steinhagen ist Direktor des Instituts für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und des Instituts für Thermodynamik und Wärmetechnik an der Universität Stuttgart. Er lehrt und forscht u.a. zur Wärme- und Stoffübertragung von Mehrphasen- und Mehrkomponentensystemen, zur Konstruktion von Wärmeübertragern, solarer Energietechnik sowie zu Brennstoffzellen. Prof. Müller-Steinhagen ist verheiratet und hat einen Sohn.
Kandidaten stellen sich uniintern vor
Auf drei Informationsveranstaltungen stellen sich die drei Kandidaten an der TU Dresden im Hörsaalzentrum, Bergstraße 64, Hörsaal 04 den Mitgliedern und Angehörigen der TU Dresden vor:
Freitag, 11.06.2010, 17 bis 18.30 Uhr: Prof. Lenz
Sonnabend, 12.06.2010, 9 bis 10.30 Uhr: Prof. Müller-Steinhagen
Sonnabend, 12.06.2010, 10.30 bis 12 Uhr: Prof. Fettweis.
[Quelle: Pressestelle TU Dresden]




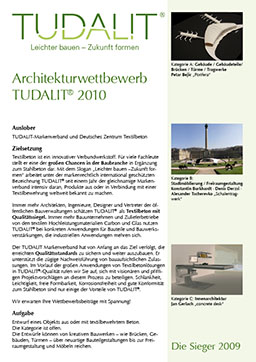 Architekturwettbewerb zum Download
Architekturwettbewerb zum Download