Die Fakultät Bauingenieurwesen lädt ein zur öffentlichen Verteidigung im Promotionsverfahren mit dem Thema „Entwicklung des Brandschutzes in Deutschland vom Späten Mittelalter bis zur Moderne (13. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert)“ von Dipl.-Ing. Sylvia Heilmann am Donnerstag, 15. Januar 2015, 14:00 Uhr, in das Sitzungszimmer Beyer-Bau, Raum 67, George-Bähr-Straße 1.
Kategorie: Institute/Lehrstühle
Endverankerung und Übergreifung textiler Bewehrungen in Betonmatrices
Die Fakultät Bauingenieurwesen lädt ein zur öffentlichen Verteidigung im Promotionsverfahren mit dem Thema „Endverankerung und Übergreifung textiler Bewehrungen in Betonmatrices“ von Dipl.-Ing. (FH) Enrico Lorenz, M. Sc. am Dienstag, 16. Dezember 2014, 13:00 Uhr, in das Sitzungszimmer Beyer-Bau, Raum 67, George-Bähr-Straße 1.
8. RFID Symposium in Dresden

Das 8. Dresdner RFID-Symposium findet am 4. und 5. Dezember 2014 an der Technischen Universität Dresden statt. Im Hörsaal 118 des Beyer Baus (George-Bähr-Straße 1, 01069 Dresden) werden ausgewählte Praxisbeispiele, Forschungsprojekte und neueste Entwicklungen aus diesem Bereich vorgestellt. Das Symposium wird von den Mitgliedern des RFID-Netzwerkes im Silicon Saxony e.V. organisiert, die sich intensiv mit RFID als einer Technologie zur Optimierung von Geschäftsprozessen beschäftigen.
Als besonderes Highlight werden die Anwendungsszenarien für RFID im Bau anhand eines Demonstrators der TU Dresden hautnah vermittelt. Darüber hinaus gibt es einen Vortrag von IBM zum Trendthema „Internet der Dinge & Industrie 4.0“. Im Rahmen der Förderinitiative Industrie 4.0 des BMBF ist die RFID Technologie neben der IT eines der infrastrukturellen Kernthemen. Weitere Vorträge beleuchten RFID-Lösungen im industriellen Einsatz und für medizinische Applikationen sowie über RFID in elektronischen Ausweisdokumenten.
Über 200 Teilnehmer bei engineered transparency
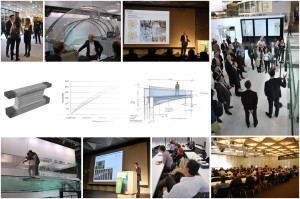
Im Rahmen der weltweit führenden Fachmesse »glasstec« fand vom 21. bis 22. Oktober 2014 die internationale wissenschaftliche Konferenz »engineered transparency« statt. Die alle zwei Jahre stattfindende Konferenz bot Informationen rund um das Thema Glas im Bauwesen. Mehr als 70 Fachbeiträge bildeten dabei den Kern der von der TU Dresden und der TU Darmstadt organisierten Tagung.
Den zahlreichen Vorträgen wohnten renommierte Keynote-Sprecher bei: Dr.-Ing. Winfried Heusler, Senior Vizepräsident bei der Firma SCHÜCO/Bielefeld, Prof. Dr.-Ing. Jan Knippers, Partner bei »Knippers Helbig« und Leiter des Instituts für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen der Universität Stuttgart/Germany, John Kooymans, Abteilungsleiter von RJC in Toronto/Canada und Christoph Timm, Gesellschafter bei SOM, New York/USA.
Mehr als 200 Teilnehmer aus 26 Ländern, darunter Vertreter von 30 internationalen Universitäten und Hochschulen, folgten den Fachvorträgen zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsergebnissen in den Bereichen des konstruktiven Glasbaus, Fassadentechnik und Solartechnik.
Zahlreiche der vorgestellten Innovationen wurden zeitgleich als Exponate im Bereich »glass technology live« ausgestellt, wo außerdem der erste Kongresstag in einem kommunikativen »get together« abschloss. Diese Sonderschau auf der mit etwa 43.000 Messebesuchern und über 1.200 Ausstellern sehr erfolgreichen »glasstec«, zeigt die neuesten Entwicklungen aus der Forschung rund um das Thema Glas. Darunter richtungsweisende Exponate wie eine neun Meter lange Spannglasbücke sowie Holz-Glas-Verbundelemente und absturzsichernde Glasgeländer mit geklebten Punkthaltern.
Die nächste »engineered transparency« findest am 20. und 21. September 2016 statt.
Katharina Lohr
Konrad-Zuse-Medaille für Prof. Scherer

Prof. Dr.-Ing. Raimar Scherer vom Institut für Bauinformatik der Technischen Universität Dresden wurde in diesem Jahr im Rahmen des 7. Deutschen Obermeistertags des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes mit der Konrad-Zuse-Medaille ausgezeichnet.
Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ehrt damit Scherers Forschungsergebnisse im Bereich Building Information Modeling (BIM). Dieses Modell der durchgängigen Digitalisierung der planungs- und realisierungsrelevanten Bauwerksdaten und deren Vernetzung birgt ein erhebliches Innovationspotenzial in der Wertschöpfungskette Bau.
„Während sich die meisten Forscher auf Anwendungen in großen Baufirmen sowie Architektur- und Ingenieurbüros konzentrieren, war es Prof. Scherer in seiner 25-jährigen Forschungstätigkeit immer ein besonderes Anliegen, die kleinen und mittleren Unternehmen in das modellbasierte Arbeiten einzubeziehen. Die Herausforderung besteht darin, einfache Bedienlösungen für mittelständische Unternehmen zu finden und trotzdem dem Anspruch der Integration in komplexe Informationsmodelle zu genügen, ohne dass Insellösungen entstehen.“ So der Präsident des Deutschen Baugewerbes, Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, in seiner Laudatio.
Professor Raimar Scherer wurde am 9. Februar 1952 geboren, er absolvierte nach der Schule eine Lehre als Bauzeichner. Von 1971 bis 1974 studierte er Bauingenieurwesen an der Fachhochschule „Würzburg-Schweinfurth“. Anschließend arbeitete er als konstruktiver Ingenieur in der Zentrale von Bilfinger & Berger in Mannheim. Noch im gleichen Jahr machte er sich mit einem Ingenieurbüro für Tragwerksplanung selbstständig. Die wissenschaftliche Arbeit hatte es ihm jedoch mehr angetan. Daher studierte er dann an der TU in München ebenfalls Bauingenieurwesen. 1979 schloss Scherer sein Studium als Diplom-Ingenieur ab. Bis 1984 blieb er wissenschaftlicher Mitarbeiter, zunächst am Lehrstuhl für Massivbau, dann im Fachgebiet „Elektronisches Rechnen im Bauingenieurwesen“.
Ab 1987 lehrte er an der Universität Karlsruhe in den Berufungsgebieten CAD und Sicherheitstheorie im Massivbau. Die praxisnahe Forschung ist Prof. Scherer wichtig. So baut er mit fünf Mitarbeitern den Bereich Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und Datenstrukturen im Bauwesen auf. Hier werden wesentliche Beiträge zur Entwicklung und Normung der BIM-Datenstrukturen geleistet.
1994 folgt er dem Ruf an die TU Dresden auf einen eigenen Lehrstuhl für Bauinformatik am Institut für Mechanik und Baustatik. Aus diesem heraus gründet er 2003 das Institut für Bauinformatik an der Fakultät für Bauingenieurwesen.
Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Scherer ist das modellbasierte Arbeiten im Bauwesen, d. h. das ganzheitliche, elektronische Informationsmanagement, das in den letzten Jahren als BIM (Building Information Modelling) bekannt wurde. Prof. Scherer ist in Deutschland zusammen mit dem Zuse-Medaillenträger Prof. Junge einer der Pioniere auf diesem Gebiet.
Die Konrad-Zuse-Medaille des ZDB wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich auf dem Gebiet der Informatik im Bauwesen in hervorragender Weise ausgewiesen haben. Ziel der Auszeichnung ist es, die Verdienste von Konrad Zuse zu bewahren und andererseits die Nutzung modernster Informations- und Kommunikationstechnologien im Bauwesen aktuell zu befördern.
[Quelle Text und Bild: Zentralverband Deutsches Baugewerbe]
Wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion
Die Fakultät Bauingenieurwesen lädt ein zur öffentlichen Verteidigung im Promotionsverfahren mit dem Thema „Wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion – Ein Beitrag zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von Spannbetonbrücken mit Hennigsdorfer Spannstahl“ von Dipl.-Ing. (FH) Tobias Wilhelm, M. Eng. am Dienstag, 4. November 2014 um 13 Uhr im Sitzungszimmer Beyer-Bau, Raum 67, George-Bähr-Straße 1.
Hanns-Bruno-Geinitz-Preis verliehen

Den Hanns-Bruno-Geinitz-Preis haben zwei junge Geowissenschaftlerinnen und ein Geowissenschaftler für herausragende Leistungen in ihrem Fachbereich erhalten. Karolin Moraweck, Dr. Nadine Janetschke und Dr. Jan Fischer wurden für ihre hervorragende Diplomarbeit bzw. Dissertationen gewürdigt.
Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wurde von den Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden im Rahmen eines Symposiums verliehen, das anlässlich des 200sten Geburtstages von Hanns Bruno Geinitz vom 16. bis 18. Oktober in Dresden stattfand.
Stifter des Preisgeldes ist Dr. Dedo Geinitz, ein Nachfahre von Hanns Bruno Geinitz (1814–1900), einem der bedeutendsten Geowissenschaftler Deutschlands und langjährigen Direktor des Königlichen Museums für Mineralogie und Geologie, den jetzigen Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden (SNSD). Er lenkte von 1847–1898 erfolgreich die Geschicke des Museums im Dresdner Zwinger und baute es zu einer der führenden geowissenschaftlichen Institutionen in Europa aus. Darüber hinaus war er Lehrstuhlinhaber für Geognosie und Mineralogie sowie Direktor der Bibliothek an der Technischen Bildungsanstalt, der späteren Technischen Universität Dresden. Geinitz legte damit schon vor über 150 Jahren den Grundstein für eine bis heute andauernde und äußerst fruchtbare Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zwischen den beiden heutigen Institutionen.
Die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden veranstalteten gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden (TU Dresden) ein Symposium anlässlich des 200sten Geburtstages von Hanns Bruno Geinitz in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden. In 18 wissenschaftlichen Vorträgen und zahlreichen Posterpräsentationen spiegelte sich die große Bandbreite der Forschung von Hanns Bruno Geinitz umfassend wider.
Auch die Ausstellung „Gespräche mit der Erde“ ist dem Dresdner Geowissenschaftler zu seinem 200. Geburtstag gewidmet. Sie präsentiert Bildbände über die Vor- und Frühgeschichte Sachsens sowie Fossilien und Gesteine – z.B. einen 92 Mio. Jahre alten Seestern aus Bad Schandau und eine Pflanzenversteinerung aus Zwickau, 310 Mio. Jahre alt. Die Ausstellung ist bis zum 19. Januar 2015 täglich von 10 bis 18 Uhr im Buchmuseum der SLUB in Dresden zu sehen und entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Museum für Mineralogie und Geologie der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden und der Geologischen Sammlungen der TU Dresden.
[Quelle]
Chancen und Risiken in der Tragwerksplanung

Die „Comödie“ im World Trade Center Dresden war am 17. Oktober 2014 für etwa 200 Fachleute Treffpunkt des 18. Dresdner Baustatik-Seminars. Die Veranstaltung wurde in bewährter Art vom Institut für Statik und Dynamik der Tragwerke der Technischen Universität Dresden in Kooperation mit der Landesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik in Sachsen und der Ingenieurkammer Sachsen ausgerichtet. Das diesjährige Leitthema lautete: Chancen und Risiken in der Tragwerksplanung.
In allen Bereichen der Ingenieurwissenschaften, so auch im Bauingenieurwesen, gibt es zahllose neue Ansätze und ideenreiche, technische Entwicklungen, z.B. im Hinblick auf neue Materialien, Materialkombinationen, Verbindungen und Technologien. Für die Berechnung der Tragwerke ist eine zutreffende Modellierung der Materialien und Strukturen erforderlich, um mit Simulationen zu realitätsnahen Prognosen des Tragverhaltens zu kommen. Diese Chancen sind in Gleichgewicht mit diversen Risiken der Praxis zu bringen. In diesem Spannungsfeld waren die Vortragsthemen breit angelegt − von der Grundlagenforschung und dem Zukunftspotential bis hin zu aktuellen Fragestellungen der Praxis − und beleuchteten die Chancen und Risiken in der Tragwerksplanung aus verschiedensten Blickwinkeln.
Neben den interessanten Beiträgen, die sich auf die verschiedensten Materialien (Holz, Beton, Stahl und Glas) konzentrierten, wurden Fragen der Qualitätssicherung von Softwareprodukten, des Bauens im Bestand und des Rückbaus von Kernkraftwerken behandelt. Im Rahmen des Seminars wurde auch über zwei interessante, große Infrastrukturprojekte (City-Tunnel in Leipzig, Dachtragwerk für den neuen Flughafen Berlin Brandenburg) berichtet, die in der Öffentlichkeit aus verschiedensten Gründen für Aufsehen gesorgt haben.
Das vollständige Tagungsprogramm ist hier verfügbar. Der Tagungsband zum Seminar kann über das Institut für Statik und Dynamik der Tragwerke der TU Dresden bezogen werden. Im Schlusswort wurde auch schon auf das 19. Dresdner Baustatik-Seminar hingewiesen, das für den 23. Oktober 2015 geplant ist.
Wolfgang Graf
Computational Methods for Reinforced Concrete Structures

„Ein Buch für Studium, Lehre und Forschung, ebenso wie für Tragwerksplaner und Prüfingenieure“ bewirbt der Verlag Ernst & Sohn das neue Buch „Computational Methods for Reinforced Concrete Structures“, das gerade erschienen ist. Geschrieben hat es Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Häussler-Combe von der Professur für spezielle Massivbauwerke. Das englischsprachige Buch gibt einen kompakten Überblick über numerische Methoden und das Materialverhalten von Stahlbeton und Spannbeton. Auf dieser Basis werden Stäbe, Balken, Stabwerkmodelle, Platte, Scheiben und Schalen untersucht und Rechenbeispiele entwickelt.
Computational Methods for Reinforced Concrete Structures behandelt die Anwendung numerischer Methoden auf die Berechnung von Stahlbetontragwerken. Rissbildung, Verbundwirkung und nichtlineares zeitabhängiges Spannungs-Dehnungs-Verhalten der Stahlbetonelemente lassen sich mit der Elastizitätstheorie allein nicht darstellen. Die Erfassung solcher Phänomene ist jedoch für die Untersuchung der Grenzzustände der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit erforderlich.
Dieses Buch gibt eine anwendungsbezogene Zusammenfassung der numerischen Methoden einschließlich FEM. Der Schlüssel dazu liegt in der Beschreibung und im Verständnis des Materialverhaltens. Die wichtigsten Materialeigenschaften von Beton und Bewehrungsstahl und ihre Verbundwirkung werden erläutert. Mit diesen Grundlagen werden verschiedene Elemente wie Stäbe, Balken, Stabwerkmodell, Platten, Scheiben und Schalen behandelt. Dabei werden Vorspannung, Rissbildung, nichtlineares Spannung-Dehnungs-Verhalten, Kriechen, Schwinden und Temperatureinwirkungen berücksichtigt.
Für alle Tragelemente werden die jeweils geeigneten Methoden hergeleitet. Dynamische Aufgaben und quasi-statische Kurzzeiteinwirkungen sowie vorübergehende Prozesse wie Kriechen und Schwinden werden gelöst. Die Problemstellungen werden anhand von zahlreichen Beispielen veranschaulicht. Diese sind mit dem Programmpaket ConFem berechnet, welches zusammen mit den Eingabedaten unter Open-Source-Bedingungen online zur Verfügung steht.
Der Autor zeigt die Möglichkeiten und Grenzen der numerischen Methoden der Baustatik zur Simulation von Stahlbetontragwerken auf.
Ulrich Häussler-Combe, Computational Methods for Reinforced Concrete Structures
354 Seiten, 184 Abbildungen, Softcover.
ISBN: 978-3-433-03054-7
59,- Euro
Auch als eBook erhältlich.
Developing a Multi-Purpose Reservoir Operating Model With Uncertain Conditions
Die Fakultät Bauingenieurwesen lädt zur öffentlichen Verteidigung im Promotionsverfahren mit dem Thema „Developing a Multi-Purpose Reservoir Operating Model With Uncertain Conditions: A case of Eastern Nile Reservoirs-Sudan“ („Entwicklung eines multifunktionalen Talsperren-bewirtschaftungsmodells bei unsicheren Rahmenbedingungen: Fallstudie für die Talsperren des östlichen Nilbeckens im Sudan“) von Mohammed Abdallah Hamadnaallah Abdallah, M.Sc. am Montag, 10. November 2O14, um 13 Uhr in das Sitzungszimmer Beyer-Bau, Raum 67, George-Bähr-Straße 1, ein.
