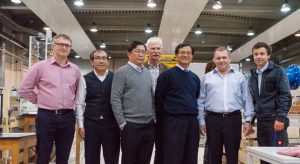Am 11.04.2017 wurde die studentische Willy Gehler-Ausstellung, die im Rahmen eines Praxisseminars des Lehrstuhls für Technik- und Technikgeschichte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Massivbau erarbeitet wurde, feierlich eröffnet. Sie widmet sich den wissenschaftlichen Verdiensten eines deutschen Bauingenieurs, der als einer der Wegbereiter das Fundament für die heutige Stahlbetonbauweise legte. Er studierte, lehrte und forschte an der Technischen Hochschule Dresden, war Konstrukteur, Normungsaktivist, Gutachter und Materialprüfer. Die Auseinandersetzung mit Willy Gehlers Leben ist allerdings zugleich eine Herausforderung, da er auch politisch engagiert in vier Systemen wirkte.
Der Ausstellungseröffnung ging an diesem Tag ein Workshop mit dem Titel „Willy Gehler – Versuch einer Einordnung“ voraus. Den Grußworten von Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach und Prof. Dr. rer. oec. habil. Thomas Hänseroth folgten interessante Vorträge zum Thema Gehler.
Dipl.-Ing. Oliver Steinbock schlüpfte für seinen Vortrag in die Person Willy Gehler – ein sehr gelungener Versuch, um den Menschen Willy Gehler zu verstehen.
Dr. Knut Stegmann beleuchtete in seinem Vortrag die Wirkphase Gehlers bei der Firma Dyckerhoff und Widmann. In dieser Zeit arbeitete Gehler an Projekten wie der Querbahnsteighalle Leipzig und der Jahrhunderthalle in Breslau.
Die Anfänge des Versuchs- und Materialprüfungsamtes der TH Dresden wurden von Dr.-Ing. Klaus Mauerberger in seinem Vortrag erläutert. Eindrucksvoll bekam man so Einblicke in die Anfänge und die Pionierarbeit des technischen Prüfwesens in Dresden.
Dr.-Ing. Karl-Eugen Kurrer von Ernst & Sohn Berlin ging näher auf Willy Gehlers Beitrag zur Baustatik ein und verstand es, mit seinem Fachwissen die Workshopteilnehmer zu begeistern. Bei einem Besuch im Café Jähnig, dem ehemaligen Wohnhaus Willy Gehlers, wurden die Diskussionen zum Workshop in lockerer Kaffeerunde weitergeführt.
Die Ausstellung kann noch bis März 2018 im Dre.Punct, Zellescher Weg 17 (Sächsische Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) besucht werden. Eine Broschüre zur Forschungsarbeit gibt zusätzlich einen informativen Überblick.
Ein besonderes Dankeschön gilt allen Beteiligten, die gemeinsam an diesem Projekt so erfolgreich gearbeitet haben.
Bericht: Sven Hofmann

(Bild: Sven Hofmann)

(Bild: Sven Hofmann)